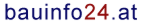
|
||||||||||
|
||||||||||
|
News | Architektur-Infos
|
||||||||||
|
News
|
|
Schnell zum Ziel
Newsletter
Fachthemen News
Soziale Netzwerke
|
|
Architektur-Infos
Beton in seiner archaischsten FormHerstellung und Einsatz von Stampfbeton
Bruder Klaus Kapelle in Wachendorf. Architekt Peter Zumthor
Foto: BetonBild Im Zeitalter neuer High-Tech-Betone und innovativer Konstruktions- und Verarbeitungsverfahren ist er nahezu komplett in Vergessenheit geraten: der Stampfbeton. Fand die archaischste aller Betonbauweisen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Einsatzmöglichkeiten - besonders beim Bau von Fundamenten und Brückenpfeilern - so gilt sie heute als geradezu exotisch. Mit der Gartenumwehrung des Kolumba-Museums in Köln und dem Neubau der Bruder-Klaus-Kapelle bei Wachendorf in der Eifel sorgte der Schweizer Architekt Peter Zumthor vor einigen Jahren für eine "Renaissance" der Stampfbeton-Architektur, die im wahrsten Sinne des Wortes "Hand und Fuß" hat. Denn das Besondere daran ist, dass der unbewehrte Beton schichtweise aufgebracht und verdichtet wird - was in früheren Zeiten mit Füßen geschah. So konnte und kann Prinzip bis heute jeder mit Stampfbeton bauen. So geschehen auch im Fall der Bruder-Klaus-Kapelle.
Der Kies der nahen Umgebung prägt die Farbe des Betons, Bruder Klaus Kapelle. / Foto: BetonBild
Über zwei Jahre dauerte es, bis die Gemeinde das turmartige Bauwerk mit den eigenen Füßen und Händen gemeinschaftlich gestampft hat. Heute kommen Architekturfreunde wie Touristen, um den ästhetischen Monolith inmitten freier Natur zu bestaunen. Entstanden aus LehmstampfbauEntstanden ist die Stampfbeton-Bauweise ursprünglich aus dem Pisé-Verfahren. Bei der seit Anfang des 17. Jahrhunderts in Frankreich bekannten Bautechnik wurde Lehm zu Wänden gestampft. In Weilburg an der Lahn nutzte der Unternehmer Wilhelm Jakob Wimpf das Verfahren Anfang des 19. Jahrhunderts, um die Wände seiner Wohn- und Geschäftshäuser - teils bis zu sechs Etagen hoch - bauen zu lassen. In der Folge kam Stampfbeton lange Zeit zur Herstellung großer Fundamente sowie im Brückenbau zum Einsatz. Seit dem Aufkommen der Stahlbetonbauweise setzte spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts der "Rückzug" ein - nicht ohne Grund. Denn mit Stampfbeton ließen sich ausschließlich unbewehrte und auf Vertikaldruck beanspruchte Bauelemente konstruieren. Hier bot der Stahlbeton vor allem im Hochbau wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Auch die im Vergleich sehr langwierige Verarbeitung und die langen Trocknungszeiten sprachen schließlich gegen den Stampfbeton.
Ästhetisches Merkmal von Stampfbeton ist die Ablesbarkeit der einzelnen Schichten. Foto: BetonBild
Handwerk mit besonderem CharmeHeute stellt die Herstellung des Stampfbetons einen natürlichen, "erfrischenden" Gegenpol zu computergesteuerten Arbeitsprozessen und hochpräzisen Betonrezepturen dar. Um eine optimale Qualität zu erreichen, muss der Beton beim Einbau um einiges trockener sein als heute im Hochbau üblich und eine erdfeuchte Konsistenz aufweisen. Durch die Zugabe spezieller Zuschlagstoffe wie Sand, Kies oder Ziegelsplitt lässt sich je nach Anforderung "Farbe ins Spiel" bringen. In die Schalung eingebracht, wird der Beton mit Geräten (oder Füßen) verdichtet. Nach jeweils einem Tag Trocknung erfolgt das Aufbringen der nächsten - in der Regel 15-25 cm dicken Schicht. Das geht so weiter, bis das Bauwerk die gewünschte Höhe erreicht hat. Besonderer ästhetischer Reiz: Die Schichten unterscheiden sich optisch durch ihre unterschiedlichen Farbnuancen voneinander. Anwendungen heuteStampfbeton wird vor allem nach wie vor insbesondere dort verbaut, wo der Einsatz großen Geräts im Gegensatz zu Umfang, Inhalt oder auch topografischer Lage der Bauaufgabe steht - zum Beispiel in der Landschaftsarchitektur für Begrenzungs- und Stützwände. In weiterentwickelter Form wird er in den USA als Walzbeton (Roller Compacted Concrete) verbreitet im Straßenbau angewandt. Und nicht zuletzt entdecken immer wieder Architekten den "gestampften Exoten" - denn archaischer lässt sich mit Beton bis heute nicht bauen.
Weitere Informationen:
|


